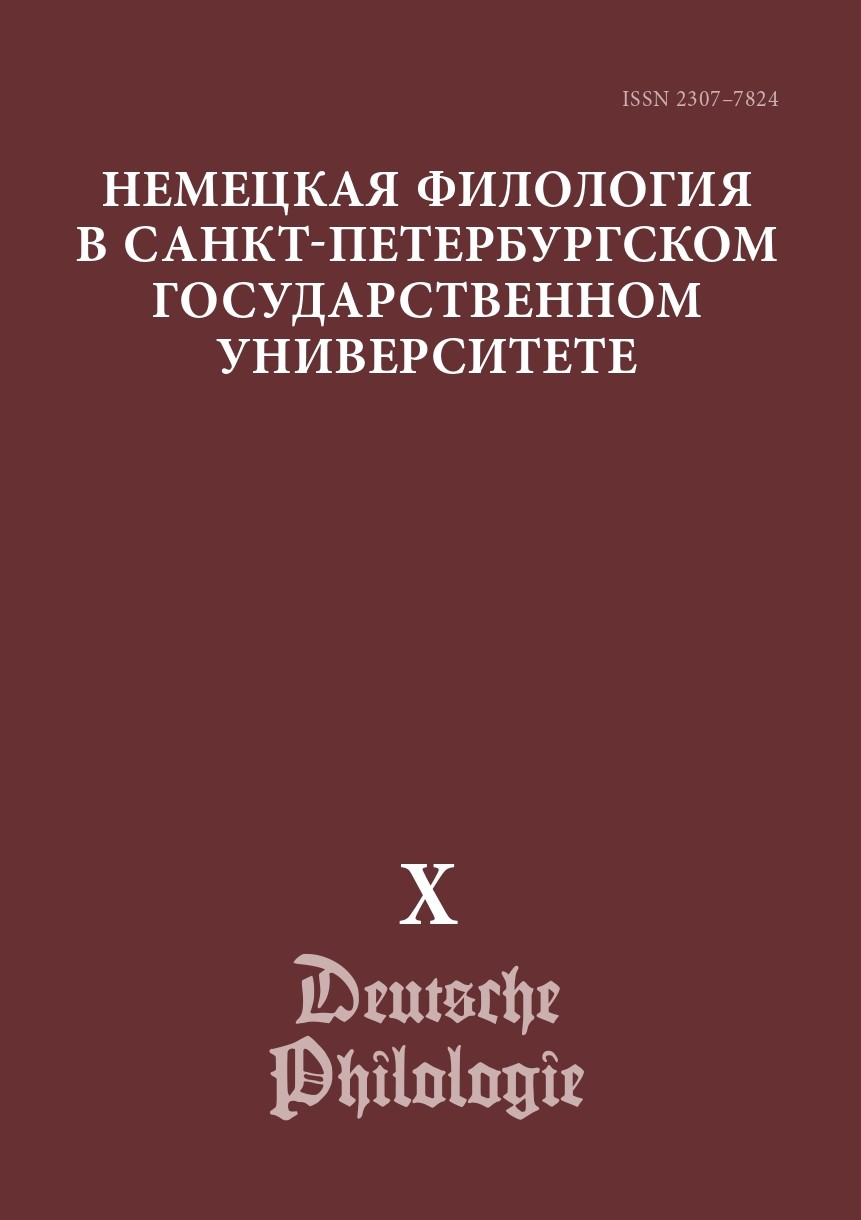DIE INFORMATIONSSTRUKTUR VON STROPHENGRUPPEN IM ALTHOCHDEUTSCHEN
Abstract
In his “Historical Syntax of German,” Admoni coins terms such as “cognition of the speaker,” i. e. speaker’s attitude, “communicative task of the sentence,” “emotional content of the sentence” in the category “Communicative, qualitative-functional and emotional aspects of the sentence.” All of these manifestations can be combined in today’s research under the term “information structure.” For the oldest language level of German, this structure is dealt with based on the Evangelienbuch by Otfrid from Weißenburg. This text is the subject of this study because Otfrid probably provided the manuscript Vindobonensis 2687, the oldest of the four surviving textual witnesses, with initials of different types. Of these initials, the initials of stanza groups are of particular interest. Depending on the intent of communication, Otfrid assigns different sections of text to the stanza group initials. Since Otfrid differentiates between narrative and exegetical sections according to the fourfold sense of Scripture, the distinction with stanza group initials not only shows which sections he wanted to be understood as coherent, but also whether he makes the placement of these initials dependent on the respective text section, be it a narrative or exegetical section. For the historical-linguistic research of the information structure, the question arises as to which information structural units Otfrid distinguishes, which types of topics, which types of focus, changing speakers, etc. The combination of information structure and stanza group initials opens up an interesting research field because it offers insights into the working and thinking style of an important person in the East Franconian empire of the late Carolingian ruler Ludwig the German. Otfrid was a monk, theologian, scholar and poet. His bible epic, written in South Rhine-Franconian dialect, the Evangelienbuch (Liber evangeliorum), is the largest completely surviving work in Old High German.
Keywords:
information structure, stanzas group initials, fourfold sense of Scripture, narration, exegesis
Downloads
References
Otfrid — Otfrid von Weißenburg. Evangelienbuch: in 2 Bdn. Bd. 1: Edition
nach dem Wiener Codex 2687 / hrsg. und bearb. von W.Kleiber unter Mitarbeit
von R.Heuser. Teil 1: Text. Tübingen: Max Niemeyer; Berlin: Walter de Gruyter,
194 S.
Abraham W. Linke Satzperipherie und versteckte Definitheitskategorie:
V1-Deklarative, Wortartunabhängigkeit und Narrativität: (Althoch)Deutsch —
Altisländisch im Vergleich // Geschichte und Typologie der Sprachsysteme / hrsg.
von M.L.Kotin, E.G.Kotorova unter Mitarbeit von M.Durrell. Heidelberg: Winter
Verlag, 2011. S. 49–68.
Admoni W.G. Die Entwicklung des Satzbaus der deutschen Literatursprache im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin: Akademie-Verlag, 1987. 2005 S.(Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Bd. 62).
Admoni W.G. Historische Syntax des Deutschen. Tübingen: Max Niemeyer, 1990. 287 S. 1064.
Axel K. Studies on Old High German Syntax: Left Sentence Periphery, Verb Placement and Verb-second. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2007. 364 p.
Concu V. Temporal Deixis in Old Saxon and Old High German: The Adverb nu in the Hêliand and Otfrid’s Evangelienbuch // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 2019. Nr. 141. S. 157–181.
Ertzdorff-Kupfer X. von. Die Hochzeit zu Kana: Zur Bibelauslegung Otfrids von Weißenburg // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1964. Nr. 86. S. 62–82.
Friedrich U. Die ,symbolische Ordnung‘ des Zweikampfes im Mittelalter.Gewalt im Mittelalter / Realitäten / Imaginationen / hrsg. von M.Braun, C.Herberichs. München: Wilhelm Fink Verlag, 2005. S. 123–158.
Hartmann H. Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Textkohärenz und Performanz bei Otfried von Weißenburg // Texttyp und Textproduktion in der deutschen Literatur des Mittelalters / hrsg. von E.Andersen et al. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2005. S. 183–201. (Trends in Medieval Philology. Bd. 7).
Haubrichs W. Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit: in 2 Bdn. Bd. 1: Die Anfänge: Versuche volkssprachlicher Schriftlichkeit im frühen Mittelalter (ca. 700–1050/60). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995. 397 S.
Haubrichs W. Heilige Fiktion?: Die Gestaltung gesprochener Sprache in Otfrids von Weißenburg Liber Evangeliorum: Vier Fallbeispiele zur inneren Sprachreflexion des karolingischen Dichtertheologen: Vox, Sermo, Res // Beiträge zur Sprachreflexion, Literatur- und Sprachgeschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Fs. U.Ruberg. Stuttgart; Leipzig: Hirzel, 2001. S. 99–112.
Haunschmidt K. Form und Funktion der Gebete in Otfrids Evangelienbuch: Diplomarbeit / Technische Universität Wien. Wien, 2017. 95 S.
Hellgardt E. Die exegetischen Quellen von Otfridss ‘Evangelienbuch’: Beiträge zu ihrer Ermittlung: Mit einem Kapitel über die Weissenburger Bibliothek des Mittelalters und der Otfridzeit. Tübingen: Max Niemeyer, 1981. 260 S.(Hermaea NF.Bd. 41).
Hinterhölzl R., Petrova S., Solt M. Diskurspragmatische Faktoren für Topikalität und Verbstellung in der ahd. Tatianübersetzung (9. Jh.) // Interdisciplinary Studies on Information Structure. 2005. Nr. 3. S. 143–182.
Hörner P. Otfrids von Weißenburg exegetische Abschnitte “moraliter, spiritaliter, mystice” // Vom vielfachen Schriftsinn im Mittelaler: Fs. für D. Schmidtke / hrsg. von F.Löser, R.G.Päsler. Hamburg: Dr. Kovač, 2005. S. 163–182. (Schriften zur Mediävistik. Bd. 4).
Kipf K. Erzähler und Autorinstanz im Heliand und in Otfrids von Weißenburg Liber evangeliorum // LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 2017. Nr. 47. S. 239–255. 10716.
Kleiber W. Otfrid von Weissenburg: Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung und Studien zum Aufbau des Evangelienbuches. München; Bern: Francke, 1971. 429 S.
Kleiber W., Heuser R. Einleitung und Apparat // Otfrid von Weißenburg. Evangelienbuch: in 2 Bdn. Bd. 1: Edition nach dem Wiener Codex 2687 / hrsg. und bearb. von W.Kleiber unter Mitarbeit von R.Heuser. Teil 2: Einleitung und Apparat / W.Kleiber, R.Heuser. Tübingen: Max Niemeyer, 2004. 314 S.
Koch E., Haferland H. Heilsteilhabe bei Otfrid: Inkulturation // Strategien bibelepischen Schreibens in Mittelalter und Früher Neuzeit (Literatur — Theorie — Geschichte) / hrsg. von B.Quast, S. Spreckelmeier unter Mitarbeit von F.Bigalke. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2018. S. 73–107. (Beiträge zu einer kulturwissenschaftlichen Mediävistik. Bd. 12).
Lühr R. Studien zur Sprache des Hildebrandliedes. Bd. 1: Herkunft und Sprache. Frankfurt a/M. ; Bern: Lang Verlag, 1982. 347 S.
Lühr R. Bedingungsstrukturen im älteren Deutsch // Historische Textgrammatik und historische Syntax des Deutschen: Traditionen, Innovationen, Perspektiven / hrsg. von A.Ziegler unter Mitarbeit von Ch. Braun. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2010. S. 157–172.
Lühr R. Zur germanischen Stabreimtechnik // Language and Meter / hrsg. von D.Gunkel, O.-O.Hackstein. Leiden; Boston: Walter de Gruyter, 2018. S.180–206.
Lühr R. Sprachliche Register im Alt- und Mittelhochdeutschen // Textgliederungsprinzipien. Ihre Kennzeichnungsformen und Funktionen in Texten vom 8. bis 18. Jahrhundert: Akten zum Internationalen Kongress an der Staatlichen Universität St. Petersburg vom 22. bis 24. Juni 2017 / hrsg. von F. Simmler unter Mitarbeit von G.Baeva. Berlin: Weidler-Verlag, 2019. S. 39–60. (Berliner Sprachwissenschaftliche Studien. Bd. 34).
Lühr R. Markierung von semiotisch-pragmatischen Funktionen in der alt
hochdeutschen Schreibtradition // Schriftkonventionen in pragmatischer Perspektive / hrsg. von V.Belfiore et al. 2020. (Im Druck).
Masser A. Bibel- und Legendenepik des deutschen Mittelalters. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1976. 202 S.(Grundlagen der Germanistik. Bd. 19).
Miedema N. Zur historischen Narratologie am Beispiel der Dialoganalyse // Historische Narratologie — mediävistische Perspektiven / hrsg. von H.Haferland, M.Meyer. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2010. S. 35–67. (Trends in Medieval Philology. Bd. 19).
Mierke G. Die Rede des Autors als Konzept — Kommunikation mit Gott im altsächsischen Heliand // Sprechen mit Gott: Redeszenen in mittelalterlicher Bibeldichtung und Legende / hrsg. von N.Miedema et al. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2012. S. 229–246. (Historische Dialogforschung. Bd. 2).
Michel P. Die Weisen aus dem Morgenland in der Deutung des Abendlands // Geschichten und ihre Geschichte / hrsg. von Th. Fuhrer et al. Basel: Schwabe Verlag, 2004. S. 237–268. 10828.
Schaller St. Verb-Erst-Stellung bei Deklarativsätzen im Althochdeutschen:
Untersuchung der markierten Verbstellung aus verbalgrammatischer Perspektive: Phil. Diss. / Technische Universität München. München, 2014. 387 S.
Schmidt M. Otfrid I 5, 56 Gidúat er imo frémidi thaz hoha hímilrichi: Zu Otfrids Verkündigungsszene // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1951. Nr. 94. S. 26–51.
Schnelle G. Funktional bedingte Variation in der Evangelienharmonie Otfrids von Weißenburg: Eine methodische Annäherung an eine variationistische korpusbasierte Registerstudie des Althochdeutschen. Berlin: Masterarbeit Humboldt Universität, 2017. 86 S.
Schröder W., Hartmann H. Otfrid von Weißenburg // Althochdeutsche und altsächsische Literatur Literatur / hrsg. von R.Bergmann. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2003. S. 322–345.
Speyer A. Die Bedeutung der Centering Theory für Fragen der Vorfeldbe setzung im Deutschen // Zeitschrift für Sprachwissenschaft. 2007. Nr. 26. S.83–115.
Wenzel H. Die ‚fließende‘ Rede und der ‚gefrorene‘ Text // Metaphern der Medialität: Poststrukturalismus Herausforderung an die Literaturwissenschaft / hrsg. von G.Neumann. Stuttgart; Weimar: Metzler, 1997. S. 481–503.
Abraham W. Linke Satzperipherie und versteckte Definitheitskategorie:
V1-Deklarative, Wortartunabhängigkeit und Narrativität: (Althoch)Deutsch —
Altisländisch im Vergleich. Geschichte und Typologie der Sprachsysteme, ed. by
M.L.Kotin, E.G.Kotorova witn cooperation of M.Durrell. Heidelberg, Winter
Verlag, 2011, pp. 49–68.
Admoni W.G. Die Entwicklung des Satzbaus der deutschen Literatursprache
im 19. und 20. Jahrhundert. (Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen, vol. 62). Berlin, Akademie-Verlag, 1987, 2005 p.
Admoni W.G. Historische Syntax des Deutschen. Tübingen, Max Niemeyer, 1990, 287 p.
Axel K. Studies on Old High German Syntax: Left Sentence Periphery, Verb Placement and Verb-second. Amsterdam; Philadelphia, John Benjamins, 2007, 364 p.
Concu V. Temporal Deixis in Old Saxon and Old High German: The Adverb nu in the Hêliand and Otfrid’s Evangelienbuch. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 2019, no. 141, pp. 157–181.
Ertzdorff-Kupfer X. von. Die Hochzeit zu Kana: Zur Bibelauslegung Otfrids von Weißenburg. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 1964, no. 86, pp. 62–82.
Friedrich U. Die, symbolische Ordnung‘ des Zweikampfes im Mittelalter. Gewalt im Mittelalter / Realitäten / Imaginationen, ed. by M.Braun, C.Herberichs. München, Wilhelm Fink Verlag, 2005, pp. 123–158. 1098.
Hartmann H. Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Textkohärenz und Performanz bei Otfried von Weißenburg. Texttyp und Textproduktion in der deutschen Literatur des Mittelalters, ed. by E.Andersen et al. (Trends in Medieval Philology. Bd. 7). Berlin; New York, Walter de Gruyter, 2005, pp. 183–201.
Haubrichs W. Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit, in 2 vols., vol. 1: Die Anfänge: Versuche volkssprachlicher Schriftlichkeit im frühen Mittelalter (ca. 700–1050/60). Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1995, 397 p.
Haubrichs W. Heilige Fiktion?: Die Gestaltung gesprochener Sprache in Otfrids von Weißenburg Liber Evangeliorum: Vier Fallbeispiele zur inneren Sprachreflexion des karolingischen Dichtertheologen: Vox, Sermo, Res. Beiträge zur Sprachreflexion, Literatur- und Sprachgeschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit: Fs. U.Ruberg. Stuttgart; Leipzig, Hirzel, 2001, pp. 99–112.
Haunschmidt K. Form und Funktion der Gebete in Otfrids Evangelienbuch: Diplomarbeit. Technical University Of Vienna. Wien, 2017, 95 p.
Hellgardt E. Die exegetischen Quellen von Otfridss ‘Evangelienbuch’: Beiträge zu ihrer Ermittlung: Mit einem Kapitel über die Weissenburger Bibliothek des Mittelalters und der Otfridzeit. (Hermaea NF., vol. 41). Tübingen, Max Niemeyer, 1981, 260 p.
Hinterhölzl R., Petrova S., Solt M. Diskurspragmatische Faktoren für Topikalität und Verbstellung in der ahd. Tatianübersetzung (9. Jh.). Interdisciplinary Studies on Information Structure, 2005, no. 3, pp. 143–182.
Hörner P. Otfrids von Weißenburg exegetische Abschnitte “moraliter, spiritaliter, mystice”. Vom vielfachen Schriftsinn im Mittelaler: Fs. für D. Schmidtke, ed. by F.Löser, R.G.Päsler. (Schriften zur Mediävistik, vol. 4). Hamburg, Dr. Kovač, 2005, pp. 163–182.
Kipf K. Erzähler und Autorinstanz im Heliand und in Otfrids von Weißenburg Liber evangeliorum. LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 2017, no. 47, pp. 239–255.
Kleiber W. Otfrid von Weissenburg: Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung und Studien zum Aufbau des Evangelienbuches. München; Bern, Francke, 1971, 429 p.
Kleiber W., Heuser R. Einleitung und Apparat. Otfrid von Weißenburg. Evangelienbuch, in 2 vols., vol. 1: Edition nach dem Wiener Codex 2687, ed. by W.Kleiber witn cooperation of R.Heuser, part 2: Kleiber W., Heuser R.Einleitung und Apparat. Tübingen, Max Niemeyer, 2004, 314 p.
Koch E., Haferland H. Heilsteilhabe bei Otfrid: Inkulturation. Strategien bibelepischen Schreibens in Mittelalter und Früher Neuzeit (Literatur — Theorie — Geschichte), ed. by B.Quast, S. Spreckelmeier witn cooperation of F.Bigalke. (Beiträge zu einer kulturwissenschaftlichen Mediävistik, vol. 12). Berlin; Boston, Walter de Gruyter, 2018, pp. 73–107. 11019.
Lühr R. Studien zur Sprache des Hildebrandliedes, vol. 1: Herkunft und Sprache. Frankfurt a/M. ; Bern, Lang Verlag, 1982, 347 p.
Lühr R. Bedingungsstrukturen im älteren Deutsch. Historische Textgrammatik und historische Syntax des Deutschen: Traditionen, Innovationen, Perspektiven, ed. by A.Ziegler witn cooperation of Ch. Braun. Berlin; New York, Walter de Gruyter, 2010, pp. 157–172.
Lühr R. Zur germanischen Stabreimtechnik. Language and Mete , ed. by D.Gunkel, O.-O.Hackstein. Leiden; Boston, Walter de Gruyter, 2018, pp. 180–206.
Lühr R. Sprachliche Register im Alt- und Mittelhochdeutschen. Textgliederungsprinzipien. Ihre Kennzeichnungsformen und Funktionen in Texten vom 8. bis 18. Jahrhundert: Akten zum Internationalen Kongress an der Staatlichen Universität St. Petersburg vom 22. bis 24. Juni 2017, ed. by F. Simmler witn cooperation of G.Baeva. (Berliner Sprachwissenschaftliche Studien, vol. 34). Berlin, Weidler Verlag, 2019, pp. 39–60.
Lühr R. Markierung von semiotisch-pragmatischen Funktionen in der althochdeutschen Schreibtradition. Schriftkonventionen in pragmatischer Perspektive, ed. by V.Belfiore et al. 2020. (Im Druck).
Masser A. Bibel- und Legendenepik des deutschen Mittelalters. (Grundlagen der Germanistik, vol. 19). Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1976, 202 p.
Miedema N. Zur historischen Narratologie am Beispiel der Dialoganalyse. Historische Narratologie — mediävistische Perspektiven, ed. by H.Haferland, M.Meyer. (Trends in Medieval Philology, vol. 19). Berlin; New York, Walter deGruyter, 2010, pp. 35–67.
Mierke G. Die Rede des Autors als Konzept — Kommunikation mit Gott im altsächsischen Heliand. Sprechen mit Gott: Redeszenen in mittelalterlicher Bibeldichtung und Legende, ed. by N.Miedema et al. (Historische Dialogforschung, vol. 2). Berlin; New York, Walter de Gruyter, 2012, pp. 229–246.
Michel P. Die Weisen aus dem Morgenland in der Deutung des Abendlands. Geschichten und ihre Geschichte, ed. by Th. Fuhrer et al. Basel, Schwabe Verlag, 2004, pp. 237–268.
Schaller St. Verb-Erst-Stellung bei Deklarativsätzen im Althochdeutschen: Untersuchung der markierten Verbstellung aus verbalgrammatischer Perspektive: Phil. Diss. Technical University of Munich. München, 2014, 387 p.
Schmidt M. Otfrid I 5, 56 Gidúat er imo frémidi thaz hoha hímilrichi: Zu Otfrids Verkündigungsszene. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 1951, no. 94, pp. 26–51.
Schnelle G. Funktional bedingte Variation in der Evangelienharmonie Otfrids von Weißenburg: Eine methodische Annäherung an eine variationistische korpusbasierte Registerstudie des Althochdeutschen. Berlin, Masterarbeit Humboldt Universität, 2017, 86 p. 11131.
Schröder W., Hartmann H. Otfrid von Weißenburg. Althochdeutsche und altsächsische Literatur Literatur, ed. by R.Bergmann. Berlin; New York, Walter de Gruyter, 2003, pp. 322–345.
Speyer A. Die Bedeutung der Centering Theory für Fragen der Vorfeldbesetzung im Deutschen. Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 2007, no. 26, pp. 83–115.
Wenzel H. Die ‚fließende‘ Rede und der ‚gefrorene‘ Text. Metaphern der Medialität: Poststrukturalismus Herausforderung an die Literaturwissenschaft, ed. by G.Neumann. Stuttgart; Weimar, Metzler, 1997, pp. 481–503.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Условия передачи авторских прав на статьи и рецензии, опубликованные в ежегодном периодическом издании «Немецкая филология» регулируются условиями Лицензионного Договора автора с Санкт-Петербургским государственным университетом. В соответствии с Лицензионным Договором опубликованные материалы находятся в открытом доступе, а авторам бесплатно предоставляется неограниченные возможности их распространения и самостоятельного архивирования.